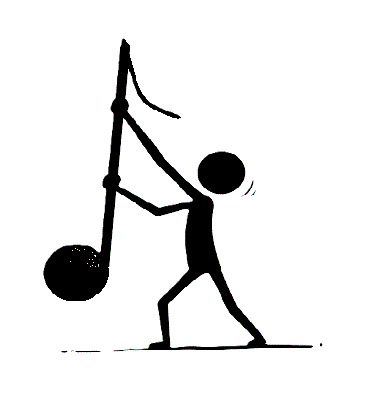1. In der Musik gibt es Leittöne
Wenn wir Musik hören, nehmen wir nicht nur Töne wahr, sondern auch Leittöne. Das sind Töne, die im traditionellen Sinn zur Verwandlung in Nachbartöne streben. Viele Musiktheoretiker und vor allem Ernst Kurth haben die Wirkung von Leittönen bereits ausführlich beschrieben. Sie sagen, dass sie bei einem Leitton eine Kraft fühlen, die ihn zur Verwandlung in einen Nachbarton drängt.
2. Bei einem Leitton identifizieren wir uns mit einem Willen
Nach der Strebetendenz-Theorie gilt jedoch genau das Umgekehrte. Sie sagt, dass wir uns bei einem Leitton mit dem Willen identifizieren, den Leitton beizubehalten, ihn gleichsam festzuhalten. Das ist vergleichbar mit der Identifikation mit dem Willen einer Filmfigur, die wir beim Anschauen eines Films erleben. Da Musik aber keine Personen und keine Handlung braucht, kann die Identifikation hier anonym verlaufen.
3. Ein Ton ist kein konkreter Gegenstand
Da ein Leitton aber kein konkreter Gegenstand ist, ist dieses Festhalten-Wollen auch nicht konkret, sondern nur abstrakt erfassbar. Es wird zum gegenstandlosen Festhalten-Wollen und kann dann als Symbol für individuelle Vorstellungen des Musikhörers dienen.
4. Leittöne als Träger der Emotion
Durch die Identifikation mit einem Willen scheint die Musik emotional gefärbt. Auch das ist vergleichbar mit der Identifkation mit dem Willen einer Filmfigur, durch die ein Film emotional erlebt wird. Da Musik aber ohne Handlung und Personen auskommt, kann man hier von anonymer Empathie sprechen.
5. Ein einfaches Beispiel: Dur und Moll
Ein C-Dur-Akkord besitzt den Leitton e. Dabei identifizieren wir uns mit dem Willen, etwas beizubehalten. Daher kann der Durakkord als Ausdruck des Einverstandenseins empfunden werden. Wechseln wir zu c-Moll, wird der Leitton e zu es erniedrigt. Das Gefühl des Einverstandenseins wird zum Gefühl des Nicht-mehr-Einverstandenseins. Der Moll-Akkord klingt nun traurig, wenn er leise ist, und wütend, wenn es laut ist. .
6. Harmonieverbindungen machen Willensinhalte konkreter
Durch die Verflechtung mehrerer Harmonien (z.B durch dominatische Beziehungen) ist es möglich, auch konkretere Vorstellungen von emotionalen Inhalten musikalisch darzustellen. Ebenso auch durch außermusikalisch vermittelte Informationen wie zum Beispiel Liedtedte oder Handlungsabläufe in Filmen.
7. Andere Faktoren manipulieren die Emotionen
Um die durch Musik ausgelösten Emotionen noch umfassender verstehen zu können, müssen wir weitere musikalische und außermusikalische Parameter berücksichtigen. Solche wurden in dem sogenannten BRECVEM-Modell von Juslin P. N., & Västfjäll, D. (2008) beschrieben.